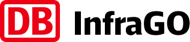Artikel: BIM-Kernelemente
Im Stufenplan „Digitales Planen und Bauen“ definiert der Bund Anforderungen an die Auftraggeber zur Erreichung des Zielniveaus 2020.
Die DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg, hat mit den fünf Kernelementen
- 3D-Planung
- Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA)
- BIM-Abwicklungsplan (BAP)
- Gemeinsame Datenumgebung (CDE)
- Modellunterstützte Planungsmeetings im virtuellen Datenraum (VDR)
Mindestanforderungen für BIM-Projekte formuliert. Diese müssen von einem Projekt umgesetzt werden, damit dieses als BIM-Projekt angesehen wird. BIM-Anwendungen, die über diese fünf festgelegten Kernelemente hinausgehen, können ergänzend projektspezifisch definiert werden.
3D-Planung
In der Planungsphase werden Fachmodelle mit geometrischen und funktionalen Eigenschaften des Bauwerks angelegt, die, je nach Leistungsphase, in verschiedenen Detailtiefen ausgearbeitet werden. Dabei ist es möglich, sich von einer groben Gesamtansicht bis zu den einzelnen Detailansichten der Planung zu bewegen. Das schafft eine anschauliche und verständliche Planungsbasis. Die Fachmodelle oder daraus abgeleitete Pläne können für alle Beteiligten und Betroffenen - vom Fachplaner über den Projektleiter, Plangenehmiger, Bauunternehmer bis hin zum Anwohner - in der für ihn relevanten Form dargestellt werden. Während die einen technisch detaillierte Ansichten erhalten, bekommen die anderen eine gut verständliche 3D-Visualisierung des Bauvorhabens.
Durch BIM bauen wir erst virtuell, dann real. Daher ist die Planung von BIM-Projekten sehr detailliert und geht in ein digitales Bauwerksdatenmodell über, mit dem während des gesamten Lebenszyklus einer Anlage gearbeitet werden kann.
Basis einer BIM-basierten Planung stellt die Sammlung und/oder die Erfassung von Bestandsdaten dar, die in ein 3D-Bestandsmodell einfließen. Dieses bildet die Grundlage für die weiteren Leistungsphasen. Alle Leistungsphasen werden mit BIM modellbasiert umgesetzt, um die Möglichkeiten der Digitalisierung möglichst effizient auszuschöpfen. So können z.B. die Fachmodelle zu einem Koordinationsmodell zusammengefügt werden, in dem Kollisionen der einzelnen Modelle bereits in frühen Planungsphasen sichtbar werden.
Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA)
In den AIA wird festgelegt, welche Informationen der Auftraggeber wann und in welcher Qualität sowie Detailtiefe benötigt. Insbesondere enthalten sie Termine, Bereitstellungswege, Strukturen und Formate der Datenlieferungen. Dies ist wichtig, damit der Auftraggeber weitreichende Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen kann. Die AIA sind feste Vertragsbestandteile, somit handelt es sich um eine klare Zieldefinition und konkrete Arbeitsanweisung entsprechend des vereinbarten Auftrags.
Der Auftragnehmer hat stets sicherzustellen, dass die digitalen Lieferobjekte den definierten Anforderungen entsprechen.
Im Hinblick auf die Besonderheiten der jeweiligen Auftraggeberstruktur und Projektanforderungen müssen AIA und BAP jeweils projektspezifisch erstellt werden. Grundlage für die Erstellung bildet ein standardisiertes Musterdokument, welches als Arbeitshilfe zur Arbeitsanweisung "BIM-Anwendung managen" veröffentlicht wurde.
Als Anlage zu den AIA wurde das semantische Objektmodell (SOM) entwickelt. Das SOM der DB InfraGO AG im Geschäftsbereich Fahrweg beschreibt die Mindestanforderungen an den Informationsgehalt der Objekte je Fachgewerk, die bei der Modellierung einzuhalten sind. Es definiert, welche Daten wann in welcher Form hinterlegt werden müssen.
Die Standardisierung des semantischen Objektmodells hat Vorteile für die Projekte selbst und für die DB InfraGO AG insgesamt. Durch Nutzung einer allgemeinen Vorlage wird der Anpassungsaufwand in den einzelnen Projekten für Fachmodelle stark reduziert. Es müssen nur noch im geringen Maße projektspezifische Ergänzungen vorgenommen werden.
Ergänzend werden den Projekten ab 2024 geometrische Bauteilvorlagen im Rahmen einer Objektbibliothek zur Verfügung gestellt.
BIM-Projektabwicklungsplan (BAP)
Der BAP beschreibt die Ziele, die organisatorischen Strukturen, Verantwortlichkeiten und Zusammenarbeit im Projekt. Im BAP beschreibt der Auftragnehmer, wie er die Anforderungen aus den AIA im Projekt umsetzt. Er wird erstmalig durch den Auftragnehmer im Rahmen der Angebotsbearbeitung erstellt. Der BAP kann als Wertungskriterium für die Zuschlagserteilung im Wettbewerb genutzt werden. Im weiteren Projektverlauf ist der BAP ein „lebendes“ Dokument, welches kontinuierlich während der Projektlaufzeit fortgeschrieben wird. Der BAP wird daher nicht als Vertragsbestandteil vereinbart. Für die Erstellung des BAP steht ebenfalls ein Musterdokument der DB InfraGO AG (Geschäftsbereich Fahrweg) zur Verfügung.
Gemeinschaftliche Prozesse der Daten- und Dokumentenverwaltung (CDE)
Die BIM-Methodik ist kollaborativ und fördert die starke Vernetzung und Zusammenarbeit der einzelnen Akteure aller Gewerke. Dazu ist eine gemeinsame Datenumgebung, das sogenannte Common Data Environment (CDE) nötig. Dieser virtuelle Projektraum ist eine Plattform, mit der alle Projektbeteiligten verbunden sind. Er ist die einzige, zentrale Datenquelle, die jeder im Projekt nutzt. So wird sichergestellt, dass alle Beteiligten stets mit aktuellen Daten arbeiten. Eine CDE verbindet Teams, Prozesse, Informationen und Systeme.
Für die DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg - wurden Rahmenverträge für CDE-Lösungen von zwei verschiedenen Anbietern abgeschlossen:
- Albert Ing. WP Squirrel
- EPLASS von ThinkProject
Die finale Auswahl, welche Plattform im konkreten Projekt genutzt wird, entscheidet sich über einen nachgelagerten Wettbewerb.
Modellbasierte Projektbesprechungen und VDR
Ein BIM-Projekt besitzt eine komplexe Struktur, in der verschiedene Fachmodelle für unterschiedliche Gewerke erstellt werden, die dann zu einem gesamthaften Koordinationsmodell zusammengefügt werden. Um die Qualität der koordinierten Planung sicherzustellen, werden in BIM-Projekten regelmäßig modellbasierte Planungsbesprechungen durchgeführt – zum Teil auch als Virtual Design Reviews (VDR) bezeichnet. Auch in der Bauausführung wird die klassische Baubesprechung durch das Arbeiten am Modell erweitert (modellbasierte Baubesprechungen).
Sie finden in der Regel in Anwesenheit von BIM-Manager:innen und BIM-Gesamtkoordinator:innen kollaborativ in Präsenz oder im virtuellen Raum statt, wobei auch weitere Rollen (z.B. BIM-Koordinator:innen, Projektleiter:innen, Projektkaufleute, ALVs, BVBs uvm.) an den Besprechungen beteiligt sein können. Konflikte und Aufgaben werden hierbei systematisch bearbeitet, dokumentiert und fortlaufend behoben.
Die konkrete Umsetzung ist in den Unteranwendungsfällen 061 “Modellbasierte Planungsbesprechung” und 062 “Modellbasierte Baubesprechung” beschrieben.
Hinweis: Die ehemalige Arbeitshilfe VDR / modellbasierte Projektbesprechung wurde durch die o.g. Anwendungsfälle abgelöst.